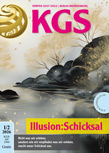Artikel aus der aktuellen Ausgabe
Aktuell
ARTIKEL aus der Ausgabe Januar/Februar 2026
- Was können wir tun? … von Wolf Sugata Schneider
- Ist das Leben vorbestimmt? … von Iljana Planke
- Geistige Heilung – Schaffung einer veränderten Wirklichkeit … von Peter Maier
- Exstatisch leben … von Wolf Sugata Schneider
- Wie man lebt, so stirbt man … von Werner Gross
- Ich bin hingegangen ... von Rainer Taufertshöfer
- Heilpflanze: Ashwagandha … von Barbara Simonsohn
- Das Evangelium des Thomas, Logion 50, … aus der Übersetzung von Jean-Yves Leloup
- Astrologische Jahresthemen 2026 … von Markus Jehle
Was können wir tun? ... von Wolf Sugata Schneider
Du und ich, was können wir überhaupt tun? Was liegt in unserer Hand und nicht in der Hand höherer Mächte? Dies können von Religionen herbei fantasierte höhere Mächte sein oder aber staatliche. Beide können uns Bürgern in der Gestaltung unseres Lebens enge Grenzen setzen. Wobei viele der von Seiten des Staates gesetzten Grenzen so nützlich sind wie (die meisten) Verkehrsregeln. Sie können jedoch auch so schädlich sein, wie etwa die Blasphemie-Gesetze in Pakistan. Oder, zurück nach Europa, das staatliche Vorgehen gegen "Desinformation", mit dem sich eine Zensur kritischer Stimmen tarnt. Andererseits sind solche Grenzen oft nur per Ängstigung erzeugte, weil wir Bürger, sei es aus Feigheit oder aus Bequemlichkeit, in unserer Angst vor Strafe oft schon vorauseilend gehorsam sind.
Höhere Mächte
Was die Macht der Religionen anbelangt, kann diese sich durch Konzepte von Himmel und Hölle oder karmischen Strafen und Belohnungen ausdrücken. Die sind zwar herbeifantasiert oder -erzählt, können dabei aber durchaus einen wahren Kern haben. Etwa den, dass unser Tun Folgen hat, den Akteur belohnende wie ihn bestrafende. Sogar das "Dein Wille geschehe" aus dem christlichen Vaterunser kann einerseits jede Rebellion schon im Keim ersticken - in spirituellen Kreisen in der Variante, einen Akt als vom Ego gesteuert zu diffamieren. Andererseits kann der Satz auch als Aufforderung zur Hingabe verstanden werden, die ja auch aus Liebe geschehen kann. Hingabe ist nicht immer ein Akt der Unterwürfigkeit, sie kann auch ein Akt der Rebellion sein aus Mitgefühl für Entrechtete und Unterdrückte.
Aufstellungen
Im Umgang mit der weltlichen Macht eines Staates brauchen wir Klugheit, vielleicht sogar Schläue. Im Umgang mit den vermeintlich höheren Mächten traditioneller Religiosität brauchen wir Einsicht, vor allem ein Durchschauen der Angsterzeugung. Seit den 1990er Jahren gibt es ein drittes Feld, das sich gegenüber den ersten beiden für modern und seelisch aufgeklärt hält: die systemischen Aufstellungen. Dort spricht man von Schicksalskräften, die unbewusst und über Generationen hinweg auf Individuen ebenso wie auf ganze Kollektive wirken und dort die Handlungsfreiheiten einschränken. Erst wenn diese Wirkung durchschaut wird, ist der Bann gebrochen und es öffnen sich Freiräume.
Prägung
Prägung erfährt allerdings jeder von uns. Jeder Einzelne und auch alle Kollektive so wie ganze Kulturen. Prägung ist unser Schicksal, sie kann nie ganz abgelegt werden. Auch die von uns als weise verehrten Individuen, Philosophien und spirituellen Lehren haben eine Herkunft. Sie sind historisch entstanden und geprägt. Typischerweise am meisten geprägt sind wir durch unsere Muttersprache, die Ernährung der Kindheit und die Bindungsformen, die wir als Heranwachsende erfahren haben. Das schränkt uns ein. Erst ein Bewusstwerden der Prägung weitet die Handlungsspielräume.
Gelassenheit
"Hat deine nun schon drei Jahre dauernde Einzeltherapie deine Probleme gelöst?", fragt sie ihn. "Nein" antwortete er, "aber sie hat mir gezeigt, wie ich damit leben kann". Seit vielen Jahren schon kursiert dieser Witz in Kreisen therapieaffiner Weisheitssucher. Er hat ja durchaus einen wahren Kern: So vieles, das mir zustößt, kann ich nicht ändern; ich kann nur ändern, wie ich damit umgehe. Von Reinhold Niebuhr ist das Gelassenheitsgebet überliefert: "Gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden."
Selbstwirksamkeit
Seit ein paar Jahrzehnten durchflutet das Konzept der Selbstwirksamkeit die Psychoszenen. Es basiert auf der Überzeugung, dass der Raum, in dem ein Individuum wirken kann, oft größer ist als dieses glaubt, und je mehr es diesen Raum für groß hält, umso größer ist er. Extremvarianten des positiven Denkens halten ihn für unendlich groß. Allerdings basiert die Größe dieses Wirkungsraums auch bei bescheideneren Denkansätzen auf einer ähnlich illusionären Idee, denn auch das Ausmaß des Glaubens an sich selbst ist bedingt. Es kann als vom Schicksal bestimmt verstanden werden und wäre dann nicht unbegrenzt autosuggestiv erzeugbar.
Der Ruf
Kann ich überhaupt irgendetwas gestalten? Große Künstler behaupten fast immer, es flösse eine Kraft durch sie hindurch. Nicht sie seien da Gestalter. Nicht das Ego wirke da, sondern durch ihre Hände, ihre Stimme, ihren Körper wirke Gott. Sie geben sich nur dieser Kraft hin. Sie können nicht anders. Oder wollen sie nicht anders? Wenn der Wille sich allerdings "dem Ruf" verweigert, kann die Schamanenkrankheit eintreten. Du hast dich geweigert, dem Ruf zu folgen, nun strafen dich diese Kräfte so lange, bis du eingesehen hast, dass du etwas Höherem dienen musst.
Gnade versus Lohn der Mühen
Wäre es da nicht besser, wir würden rechtzeitig lernen uns diesen Rufen nicht zu widersetzen? So viele mysteriöse chronische Krankheitssyndrome würden dann gar nicht erst entstehen. Vielleicht würde auch das Ego schon früh belehrt, kein autonomes Wesen zu sein. Denn auch in unserer Individualität sind wir bedingte, dem großen Ganzen ausgelieferte Wesen. Selbst wenn wir "uns gefunden" haben, ist dieses Finden eher Gnade als Belohnung für erbrachte Anstrengungen. Solche Gnade erfährt typischerweise allerdings erst, wer sich anstrengt, oft bis zur Erschöpfung. Sie tritt erst ein, wenn du "am Ende bist und nicht mehr kannst".
Ganz sein
So möchte ich mich im Tun in den Flow stürzen, im Nichtstun hingegen mich fallen lassen in die Einsicht. Hineinsterben in mein aktuelles Tun, mich dem hingeben, so wie jetzt beim Schreiben dieses Textes. Oder aber Einsinken in die Stille, die Leere des Nichts, den Abgrund meines unendlichen Inneren. Beides kann ekstatisch sein. Dies zu wissen ist Holismus, Dasein im Ganzen, ganz sein. Es zu können ist Lebenskunst.
Gott braucht mich
So ist das Wort "ich" nicht etwa an sich schon eine Blasphemie, weil doch alles von Gott ist, sondern es ist der nötige Gegenpol des vom Subjekt erfahrenen Ganzen. Ohne wahrnehmendes Ich gibt es nichts Göttliches. Gott braucht nicht nur meine Hände, um etwas tun zu können, er/sie/es braucht meine Augen, um zu sehen und meine Haut, um zu fühlen. Indem ich kreativ bin, schöpferisch, bin ich nicht mehr nur Kreatur, etwas Erschaffenes. Als kreativer Mensch bin ich Schöpfer, Gott und Göttin zugleich, Weltenmutter Gaia und ihr kreativer Impuls.
Einbildung
In diesem Verständnis hebt sich die Frage auf, ob ich überhaupt irgendetwas bewirken kann oder komplett dem Schicksal ausgeliefert bin. Es gilt beides. Mein Wirkungsraum ist faktisch vorhanden. Seine Grenze jedoch ist Fiktion, sie ist so eingebildet wie mein wirkendes Ich. Beides nur eingebildet? Nein, immerhin eingebildet! Das Wort Einbildung stammt von Meister Eckhart, ebenso wie das Wort Bildung. Er meinte damit das Sich-einbilden von etwas Äußerem ins Innere. Eine Art Ichwerdung oder Identifikation. Jede Bildung, die ich mir aneigne, ist insofern Einbildung, angeeignete Bildung.
Verendend entstehen wir neu
Wir oder ich, bei beidem stellt sich die Frage "Ego oder Gott". Ist es egoistisch Nationalbewusstsein zu haben? Ach, würden die Politiker sich doch endlich mal auch solche Fragen stellen! Deutschland, Europa, die Ukraine und Russland, so wenig wie mein Ich etwas Festes ist, so wenig sind es diese Kollektive. So wie ich und du werden auch diese Kollektive geboren und sterben, und auch zwischen Geburt und Tod verändern sie sich ständig, kristallisieren sich und verenden, verpuppen und entstehen neu. Wenn auch kollektive Gebilde wie das Donezbecken so betrachtet würden wie heute das Elsass, das nun nicht mehr "uns gehört", gäbe es keine Kriege mehr.
Wolf Sugata Schneider, Jg. 52. 1985-2015. Hrsg. der Zeitschrift Connection. Autor von »Sei dir selbst ein Witz« (2022). www.connection.de, www.bewusstseinserheiterung.info, www.ankommen.website
Hinweis zum Artikelbild: © Wirestock – AdobeStock
Ist das Leben vorbestimmt? ... von Iljana Planke
Es gibt unterschiedliche Meinungen dazu, ob überhaupt etwas und wenn ja, was genau vorherbestimmt ist und was man trotzdem selber in der Hand hat. Vielleicht unterscheidet sich das auch danach, in welchem Level die Seele spielt. Das heißt, unerfahreneren Seelen wird vielleicht noch mehr vorgegeben werden als denen, die sich schon auskennen.
Die Pläne der Einzelnen, von Gruppen, Völkern und der Welt sollen in der sogenannten "Akasha-Chronik" stehen, dem "Buch des Lebens". Das ist eine Art vollumfängliches Weltgedächtnis. Es ist sozusagen die "Wissens-Cloud" der universellen Ebene.
Ein ganz kleiner Teil aus der Akasha-Chronik soll auf Palmblättern vor langer Zeit niedergeschrieben worden sein. Die handschmalen "Blätter" sind auf dem harten Mittelteil der Stechpalmwedel geschrieben und bei guter Lagerung sehr haltbar. Sie zerbrechen erst nach achthundert Jahren. Die Palmblätter werden nach mehreren hundert Jahren auf neue Palmwedel abgeschrieben. Ein Palmblätterbündel beinhaltet Informationen über die Vergangenheit, die Potenziale und die Zukunft eines Menschen. Am Anfang des Blätterbündels steht dessen Name. Jeder kann sich seins in der Palmblattbibliothek vorlesen lassen.
Die Autorin des Buches "Wege des Schicksals", Annett Friedrich, beschäftigt sich seit rund dreißig Jahren mit der Palmblattbibliothek und bietet geführte Reisen dorthin an. Sie fasst ihre vielen Gespräche mit den Vorlesern der Palmblätter und mit denjenigen, die aus ihren Palmblättern vorgelesen bekamen, so zusammen: "Die Schicksale gelten nicht als unabwendbar, sondern können sich im Laufe der Zeit auch ändern."
Es heißt, dass 70 bis 80 % unseres Lebens vorbestimmt sei, die restlichen 20 bis 30 % sind unsere Wahl - jeden Tag wieder neu. Mit diesem selbstbestimmbaren Anteil können wir eine bestehende Lebensausgangslage recht vielfältig gestalten. Ein Beispiel: Angenommen zehn Frauen bekämen die Aufgabe, eine Kartoffel-Gemüse-Suppe zu kochen. Sie erhielten dafür zu 80 % das Gleiche - also Kartoffeln, dreierlei Gemüse, Wasser und Salz. Die anderen 20 % der Gesamtmenge kann jede der Frauen frei wählen, ob Brühwürfel, Sahne, Öl, vegane Würstchen, Zwiebeln, Speck, Kräuter, weitere Gemüsesorten, Wein, Curry, Mango, Kokosmilch etc. Am Ende würden dies alles Kartoffel-Gemüse-Suppen sein, aber jede Suppe würde anders schmecken, denn 20 % machen einen wirklich großen Unterschied.
Wie kommt eine Seele zu ihren Aufgaben?
Es heißt, die Seele plant zusammen mit den universellen Instanzen und anderen Seelen, die sie treffen möchte, ihr nächstes Leben. Zur Konzeption gehören die Fragen: In welche familiären und gesellschaftlichen Zusammenhänge möchte ich kommen? Wen möchte ich wiedertreffen? Wo ist noch etwas offengeblieben? Was sollte passieren, damit ich etwas lernen oder für andere tätig sein oder reifen kann? Was möchte ich tun? Was möchte ich für mich und andere erreichen? Wo möchte ich für etwas Größeres tätig werden? Das ist in etwa so, wie wir in unserem realen Leben unsere gegenseitigen Besuche, die Urlaube, unsere Ausbildungen, Arbeitsplätze und Umzüge planen. Dabei ist die Persönlichkeit der ausführende Part für die Pläne der Seele.
Auch die Seele meiner Hündin Susi saß wohl vor ihrer Inkarnation auf einer Himmelswolke und blätterte in den Reisekatalogen mit den Titeln "Als was wollen Sie in Ihrem nächsten Leben wohin und mit welchen Zielen reisen?" Sie dachte sich damals wahrscheinlich: "Also erst mache ich dies und das mit meinem geliebten Herrchen und danach gönne ich mir etwas Nettes. In dem Leben werde ich es mir so richtig gut gehen lassen. Erst bei ihm und auch danach. So etwas ist auch mal wichtig. Hach ja, ich werde mich verwöhnen lassen." Denn egal, wann ich sie per telepathischer Tierkommunikation nach ihren Seelenaufgaben fragte, kam von ihr immer: "Ich möchte mich einfach nur wohlfühlen." und "Eigentlich keine" - Sie meinte das im Sinne von "Eigentlich keine mehr, denn ich habe schon alles in den Jahren vor dir erledigt." Sie schien sich für ihre Lebensphase bei mir ein Urlaubsleben gebucht zu haben. Was sie auch bekam.
Was mache ICH aus meinem Leben?
Ich finde im Zusammenhang mit der Vorherbestimmung eine weitere Frage interessant: Egal, ob etwas und wie viel im Leben vorbestimmt ist - was mache ich trotzdem aus meinem Leben? Aus jedem Tag? Aus jeder Begegnung?
Für mich ähnelt das Leben dem Weben eines Stoffes. Beim Webrahmen werden als erstes zwischen dem waagerechten oberen und unteren Holm die Kettfäden aufgezogen. Das sind die Stränge zwischen unten und oben. Sie können später nicht mehr verändert werden. Diese Lebensstränge sind die vorgegebenen Planungen der Seele, die sie zusammen mit den universellen Instanzen und mit anderen Seelen machte. Das wären die Eltern, die genetischen Komponenten, das Umfeld und die Begegnungen in der Kindheit, der Jugend und im Erwachsensein, die Vorlieben und Fähigkeiten. Dann geht es los mit dem Weben, denn nun kommt das tägliche Leben mit all seinen Situationen und Erlebnissen. Jeder Tag ist ein Faden. Beim Weben beginnt man am unteren waagerechten Holm, quasi bei der "Erde", und legt den nächsten Faden eins höher über den vorigen, bis man am oberen Holm, dem "Himmel", angekommen ist. Das irdische Leben wächst zum Überirdischen hin. Das alte mittelhochdeutsche Wort "irdisch" steht für "erdhaft", das Wort "überirdisch" steht für den Himmel, weil der sich "über der Erde" befindet. Innerhalb der vorgegebenen Stränge ist Raum für das eigene Gestalten seines Lebens.
Was wäre, wenn?
Ich hätte vor über 15 Jahren nicht den Schritt in die Selbständigkeit machen müssen, ich hätte meine Hündin Susi nicht aufnehmen müssen, ich hätte auch nicht Bücher schreiben müssen. Ich hätte diese lebendigen Impulse auch unterdrücken können. Dann wäre ich immer noch eine Angestellte mit viel Freizeit. Aber dann würde mein Lebensstoff wahrscheinlich eher monoton aussehen und das Weben würde mich jeden Tag etwas mehr anstrengen. Und am Lebensende würde ich bestimmt bedauern, soviel Schönes, das mir wie Weihnachtsgeschenke in die Hände gelegt wurde, immer wieder zurückgegeben zu haben.
Iljana Planke bietet seit über zwanzig Jahren in ihrer Praxis in Berlin Tierkommunikation, Reiki für Tiere, Spiegeln-Hinterfragen sowie Seminare und Onlinekurse dazu an und hat die Bücher „Tierkommunikation“, „Reiki-Techniken für Tierbehandlungen“ und „Wie Tiere Menschen spiegeln“ veröffentlicht. Infos unter www.Mit-Tieren-kommunizieren.com
Hinweis zum Artikelbild: © Ilja – AdobeStock
Geistige Heilung – Schaffung einer veränderten Wirklichkeit ... von Peter Maier
Der Ansatz von Dr. Joe Dispenza
Während der Italienreise 2021 empfahlen mir fast gleichzeitig und unabhängig voneinander vier mir nahestehende Personen das Buch "Ein neues Ich" von Dr. Joe Dispenza. In seinem Buch, das ich innerhalb von nur einer Woche durcharbeitete, erfuhr ich zunächst Interessantes über die persönliche Entwicklung und den geistig-wissenschaftlichen Ansatz von Dr. Dispenza selbst: Seine Ausbildungen und Fortbildungen beziehen sich unter anderem auf die Bereiche Chiropraktik, Neurologie, Gehirnfunktionen, Chemie, Zellbiologie, Epigenetik und Gedächtnisbildung. Dr. Dispenza ist davon überzeugt, dass wir mit einer positiven Art zu denken unser Gehirn tatsächlich neurologisch neu verschalten können und dass jeder Mensch prinzipiell nahezu unbegrenzte Entwicklungsmöglichkeiten in sich trägt, die im universellen Quantenfeld für uns gespeichert sind. Diese Möglichkeiten stehen für uns permanent bereit und können daher jeder Zeit abgerufen und genutzt werden. Dr. Dispenza ist der Ansicht, dass eine Veränderung unseres Denkens unseren Geist und durch epigenetische Beeinflussung der Zellen auch unseren Körper wesentlich verändern kann.
Krise als Chance: eine furchtbare Rückenverletzung und ihre Heilung
Dr. Dispenza hatte vor über 30 Jahren ein einschneidendes Erlebnis: einen brutalen Fahrradunfall, bei dem er von einem Auto angefahren und auf die Straße geschleudert wurde. Dabei wurde seine Wirbelsäule massiv verletzt. Die Röntgenbilder waren grässlich. Die Ärzte prognostizierten ihm eine dauerhafte Lähmung unterhalb des Halses ohne Aussicht, jemals wieder gesund werden zu können.
Doch nun machte Dr. Dispenza etwas Erstaunliches: Er fokussierte sich jeden Tag stundenlang ohne Unterbrechung auf seine Wirbelsäule und malte sich geistig aus, wie die zerfetzten Bandscheiben wieder zusammenwuchsen und die gesplitterten Wirbel heilten. Diese intensive geistige Innenarbeit ging über mehrere Wochen, Dr. Dispenza ließ nicht davon ab. Das Überraschende war, dass in seinem Körper wider jede ärztliche Erwartung tatsächlich genau das geschah, was er zuvor geistig visualisiert hatte: Seine Bandscheiben und Wirbel heilten. Unglaublich für die behandelnden Ärzte und für ihn selbst! Das war "das" Schlüsselerlebnis im Leben von Dr. Dispenza. Nach einigen Wochen konnte er wieder aufstehen und die ersten Gehversuche machen, nach einigen Monaten war er wieder ganz gesund und die Schäden, die die Röntgenbilder unmittelbar nach dem Unfall gezeigt hatten, waren komplett verschwunden.
In seinen Büchern und Vorträgen weltweit gibt Dr. Dispenza seither diese seine Erfahrung weiter. Er möchte dabei die Menschen aufrütteln, aus ihren oft destruktiven Denkstrukturen und eingefahrenen Verhaltensmustern auszubrechen, neue geistige Vorstellungen für sich zu entwickeln und so ihr Leben positiv zu verändern. Nun könnte man einwenden, dass es ja gerade in den USA schon lange vor Dr. Dispenza die Bewegung des "Positiv Thinking" gegeben hat, mit dem durch neues Denken neue Ziele erreicht werden können. Nach Dr. Dispenza haben solche Ansätze jedoch meist keine wirkliche Durchschlagskraft und nachhaltige Wirkung, denn ihnen fehlt ein wesentlicher Aspekt. Seine entscheidende Erkenntnis war:
Man muss die neuen Visionen unbedingt mit positiven Emotionen verbinden, wenn sie Wirklichkeit werden sollen.
Ein Beispiel soll klar machen, was damit gemeint ist. Statt sich etwa als Onkologie-Patient beständig nur als Opfer zu fühlen und das Göttliche oder das Universum klagend um Heilung zu bitten, empfiehlt Dr. Dispenza, sich in einem solchen Fall beim universellen göttlichen Quantenfeld gleich um die bereits erfolgte Heilung zu bedanken und sich innerlich schon mit Freude gesund zu fühlen; so zu tun, als ob man bereits gesund wäre; den neuen Gedanken also mit einer positiven Emotion zu verbinden. Ein psychologischer Trick? Ja, vielleicht, nach Dr. Dispenzas Ansicht aber ein sehr erfolgreicher. Denn schon bei vielen seiner Patienten und Zuhörern hat dieses Prinzip eine positive Wirkung erzeugt. Dr. Dispenza begründet seinen Ansatz so:
"Wir alle sind gesegnete Wesen; wir alle können die Früchte unserer konstruktiven Bemühungen ernten. Wir müssen uns nicht mit unserer gegenwärtigen Realität abfinden; wir können eine neue erschaffen, wann immer wir wollen. Wir alle verfügen über diese Fähigkeit, denn unsere Gedanken beeinflussen unser Leben - im Guten wie im Schlechten."
Ein kurzer Ausflug in die Quantenphysik
Dr. Dispenza verwendet wichtige Erkenntnisse der Quantenphysik für seine Theorie. (Im Folgenden werden die Seitenzahlen aus seinem vorab genannten Buch angegeben, in denen die Zitate zu finden sind:)
So, wie ein Atom fast nur aus Energiefeldern und kaum aus Materie besteht, so existiert der Mensch nach Dr. Dispenza vor allem aus Geist und nur zu einem sehr geringen Prozentsatz aus Körper (Materie). Und Geist ist für ihn eine Form von Energie. (S. 21)
Dieser Gedankengang wird noch durch eine andere Analogie aus der Quantenphysik bestärkt: Quantenobjekte wie etwa Protonen oder Elektronen haben nicht nur physische, sondern vor allem energetische Qualitäten. Denn in Wahrheit existiert Materie bei Quantenobjekten nur als momentanes Phänomen. Ein Elektron kann tatsächlich im dreidimensionalen Raum als beobachtbares Teilchen erscheinen, entschwindet danach aber wieder ins Nichts, in den Nicht-Raum, in die Nicht-Zeit, in das sogenannte "Quantenfeld". Es wird dabei vom Partikel (Materie) zur Welle (Energie) transformiert. Das gleiche geschieht laufend auch umgekehrt. (S. 42 f.)
Aber die Quantenphysik geht noch einen Schritt weiter. Denn bei einer Beobachtung, etwa in einem physikalischen Experiment, werden Quantenobjekte wie Elektronen oder einzelne Atome durch diese Beobachtung selbst massiv beeinflusst. Dieses Phänomen kann so formuliert werden: "Wie Quantenexperimente zeigen, existieren Elektronen gleichzeitig in einer unendlichen Zahl von Möglichkeiten in einem unsichtbaren Energiefeld. Doch erst wenn ein Beobachter bzw. Betrachter seine Aufmerksamkeit auf irgendeine Position eines beliebigen Elektrons richtet, taucht dieses Elektron auf.
Anders ausgedrückt: Ein Partikel kann sich in der Realität - also auf dem ge-wöhnlichen, uns bekannten Raum-Zeit-Gefüge - erst dann manifestieren, wenn es beobachtet wird. Dieses Phänomen heißt in der Quantenphysik 'Kollaps der Wellenfunktion' bzw. 'Beobachter-Effekt'." (S. 44). Elektronen existieren somit in der Regel nicht als Materie, sondern als Energie in Form von Wahrscheinlichkeitswellen, die das Potential unendlich vieler Möglichkeiten beinhalten.
Anwendung der Quantenphysik auf das persönliche Leben: Kreation eines neuen Ichs
Dr. Dispenza überträgt nun dieses soeben beschriebene Phänomen bei Quantenobjekten auf die Möglichkeiten für den menschlichen Geist, der für Dispenza eine Form von Energie ist: "Angesichts dieser Entdeckung kann man Geist und Materie nicht mehr als voneinander getrennte Phänomene betrachten; sie sind untrennbar miteinander verbunden, denn der subjektive Geist erzeugt messbare Veränderungen in der objektiven physischen Welt." (S. 44)
So, wie durch ein vom Physiker ausgedachtes (Geist!) Experiment ein Elektron, das bis dahin nur als Wahrscheinlichkeitswelle und damit als Energie existiert hat, beim Beobachten zu Materie wird, so können auch wir unser ganz persönliches Leben verändern: indem wir die vielen im Quantenfeld existierenden geistigen Möglichkeiten unseres menschlichen Seins gedanklich in eine ganz bestimmte, von uns ausgewählte Realität "kollabieren" lassen. (S. 44 f.) "Die Energie unendlicher Möglichkeiten wird vom Bewusstsein, Ihrem Geist, wie Ton geformt ... Geist und Materie sind komplett miteinander verwoben - um es in der Quantensprache auszudrücken - 'verschränkt'… Sie haben die Macht, Materie zu beeinflussen, weil Sie auf der grundlegendsten Ebene Energie mit Bewusstsein sind. Sie sind Materie mit einem aufmerksamen Geist." (S. 45 f.)
Dem Quantenmodell nach interpretiert man heute das physische Universum als " ... ein immaterielles, zusammenhängendes, einheitliches Informationsfeld, das potentiell alles, physisch aber nichts ist." (S. 46). Danach kann ein bewusster Beobachter durch seinen Geist auf die Energie in Form von potentieller Materie Einfluss nehmen und so Wellen energetischer Wahrscheinlichkeiten in (physische) Materie umwandeln. Auf diese Weise kann man im Leben etwas schöpferisch bewirken und verändern, willentlich auf sein Schicksal Einfluss nehmen und eben ein neues Ich kreieren.
In seinen Forschungen mit vielen Klienten hat Dr. Dispenza festgestellt, dass das Quantenfeld meist nicht isoliert unsere Wünsche (emotionale Anforderungen) oder unsere bloßen mentalen Ziele umsetzt: "Es reagiert erst, wenn beides aufeinander abgestimmt bzw. kohärent ist, wenn also Gedanken und Emotionen dasselbe Signal aussenden. Kommt eine erhebende Emotion mit einem offenen Herzen und eine bewusste Intention mit einem klaren Gedanken zusammen, geben wir dem Feld das Signal, auf wunderbare Weise zu reagieren."
"Das Quantenfeld reagiert nicht auf das, was wir wollen; es reagiert auf das, was wir sind."(S.52)
Dr. Dispenza ist sich damit vollkommen klar, dass die besten Gedanken allein meist nichts bewirken. Entscheidend ist, dass diese neuen Gedanken mit neuen, glücklichen Emotionen verbunden werden. Dazu muss man jedoch die von Dr. Dispenza selbst bei seinen Erklärungen so favorisierte Ebene des analytischen Denkens verlassen und in die Meditation gehen, also von einer nur linkshirnigen Betrachtung mit hochfrequenten Beta-Gehirn-Wellen in den viel langsamer schwingenden rechtshirnigen Alphazustand umswitchen. Denn nur auf dieser zweiten Ebene sind die Emotionen zu Hause.
Der Ansatz von Dr. Dispenza enthält somit beides: Er macht uns überhaupt erst einmal klar, welch großes gedankliches Potential für uns im Quantenfeld existiert. Damit will er blockierende Verhaltensmuster und unnötige Einschränkungen in unserem Denken und bei unseren Vorstellungen aufbrechen. Dieser erste Schritt ist aber nur die (unbedingte) Voraussetzung für den zweiten: nämlich die neuen Gedanken in der Meditation mit positiven Emotionen zu verbinden und sie erst so Realität werden zu lassen.
Der Fall Andreas (67) - praktische Anwendung Dispenzas durch einen bayerischen Heiler
Eine schmerzliche Muttererfahrung
Andreas hatte eine schmerzliche Muttererfahrung gemacht. Als selbst traumatisiertes Kriegskind war sie nicht in der Lage, ihm Mutterliebe zu geben und sich in einen wirklichen Symbiose-Prozess einzulassen. Zudem verschwand sie aufgrund einer Brustentzündung bereits sechs Wochen nach seiner Geburt für 23 Tage ins Krankenhaus. Während dieser Zeit wollte sie ihr Baby nicht sehen. Daher musste Andreas mit seiner Oma vorlieb nehmen, die zwar die nötigsten Funktionen erfüllte, ihm aber ebenso keine Liebe geben konnte. Auch in den Jahren danach kam er oft jeweils für mehrere Tage zu dieser Oma.
Die Folge: In Andreas gab es Zeit seines Lebens ein furchtbares Mutter-Liebes-Loch in seiner Seele. Das einzige Wesen, das ihm psychisch das Überleben garantierte, war das damals siebenjährige Nachbarsmädchen, das ihn immer wieder auf den Arm nahm und an ihr Herz drückte, wenn er bei der Oma war. Das war zwar besser als nichts, aber viel zu wenig, um seine inneren Speicher mit echtem "Liebesfluidum" zu füllen.
Dennoch hatte Andreas vielleicht genau wegen dieser Erfahrung eine beständige Liebessehnsucht in sich, die aber niemand stillen konnte. Auch eine acht Jahre dauernde Psychotherapie konnte dies nicht erreichen, ebenso viele andere Therapieversuche nicht. Durch das Mädchen wusste er aber ganz innen, dass es diese Liebe gab, nach der er sich so sehnte und die er wie eine emotionale Nahrung brauchte, aber er spürte an der Stelle seines Herzens ein ganzes Leben lang nur ein schwarzes Loch, gerade so, als ob man ihm das Herz herausgerissen hätte. Das bewirkte eine ständige Unruhe in ihm. Was sollte er tun?
Aus seinem Bekanntenkreis erfuhr er von der Existenz eines Heilers namens Helmut, der mit seinen Klienten ausschließlich telefonisch kommuniziert. Er wohnt am Ammersee. Sein Heilungsansatz ist von Dr. Dispenza beeinflusst, jedoch arbeitet er nicht mit neuen (rationalen) Vorstellungen, sondern mit inneren Bildern. Seiner Ansicht nach wirken solche "inneren Bilder", auch "Seelen-bilder" oder "schamanische Bilder" genannt, direkt auf die Seele. Lässt man sich - mit einer positiven Emotion verbunden (siehe Dispenza zuvor) - auf solche Bilder ein, so können sie in dem Betroffenen eine neue Wirklichkeit kreieren. Andreas erzählte nach solch einer telefonischen Heilbehandlung folgendes:
Kreieren einer neuen Wirklichkeit
"Helmut fragte mich ab, ob es in meinem Leben jemals eine Person mit echter Liebe geben habe. Sofort fiel mir das damalige Nachbarsmädchen ein. Das war ein sehr guter Ansatzpunkt für das innere Bild, das mir Helmut danach anbot: Meine Mutter und meine Oma klopften im Nachbarhaus. Sofort öffnete das Mädchen die Türe.
Ich sah mich, wie ich meine Arme nach dem Mädchen ausstreckte. Sie nahm mich und drückte mich sofort fest an ihr Herz. Hinter ihr stand ihre Mutter, die ebenfalls sofort liebevoll ihren Arm um mich als Baby legte. Nun fragten meine Mutter und meine Oma, ob sie mich bei den Nachbarn in Pflege geben könnten, denn sie selbst hätten keine Liebe, die beiden weiblichen Wesen im Nach-barhaus jedoch sehr wohl. Voll Freude stimmten das Mädchen und ihre Mutter diesem Vorschlag zu und versprachen meiner Mutter und Oma, dass sie jeder Zeit kommen könnten, um mich zu sehen.
Nun erlebte ich, wie ich sowohl bei dem Mädchen als auch bei ihrer Mutter täglich mehrmals mit Liebesfluidum aufgeladen wurde bis ich satt war. Mein Herzraum füllte sich immer mehr mit Liebe und Freude. Allen ging es gut - mir, weil ich endlich das bekam, was ich bei Mutter und Oma so sehr vermisst hatte; dem Mädchen und ihrer Mutter, die so voll Liebe waren und nun endlich in mir ein ‚Liebesobjekt' hatten, dem sie ihre Liebe schenken konnten. Ich spürte, wie großer Stress aus mir als Baby wich und große Fülle an Liebe und (Lebens)Energie in mich einströmten. Nun wurde ich in meinen psychischen Fundamenten nachhaltig von meinem Liebesloch geheilt und das war wunderbar. Ich sah mich immer wieder als kleines Baby strahlen vor Glück und Zufriedenheit."
Reflexion
Nach Dr. Dispenza kann unser Gehirn nicht unterscheiden zwischen einer realen Erfahrung und einer intensiven geistigen Vorstellung. Im Falle von Andreas wurde dieses innere geistige Bild von den liebevollen Wesen in seiner Nachbarschaft zu einer neuen geistigen und seelischen Erfahrung und damit zu einer neuen Wirklichkeit.
Tatsächlich fühlte sich Andreas bereits nach einigen Wochen immer entspannter und zufriedener, seit ihm der Heiler dieses innere Bild gegeben hatte. Offenbar war die neue Vorstellung zu einer neuen Wirklichkeit in ihm geworden, die sein altes reales seelisches Trauma ablöste. Andreas erlebte dies als wunderbare innere Heilung.
Peter Maier: Lebensberatung, Supervision, Autoren-Tätigkeit
Bücher von Peter Maier:
WalkAway - Jugendliche auf dem Weg zu sich selbst. Epubli Berlin 2023
Heilung - Die befreiende Kraft schamanischer Rituale. Epubli Berlin 2022
Heilung - Plädoyer für eine integrative Medizin. Epubli Berlin 2020
Heilung - Initiation ins Göttliche. Epubli Berlin 2020
Nähere Infos und Buchbezug:
www.alternative-heilungswege.de
www.initiation-erwachsenwerden.de
Hinweis zum Artikelbild: © altanaka – AdobeStock
Ekstatisch leben ... von Wolf Sugata Schneider
Was ist ein gutes Leben?
Die Frage danach, was ein gutes Leben ist, geht in den Routinen des Alltags oft unter. Ganz verdrängen können wir sie jedoch nicht. Wozu bin ich eigentlich da, und was mache ich hier den ganzen Tag, teils lebenslänglich - ist das gut so, entspricht mir das, hat die Existenz mich so gemeint?
Wie wir danach fragen, ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Mich bewegte schon zu Schulzeiten die Frage nach dem, was gut und wahr ist, so sehr, dass ich oft weglaufen wollte aus dem Gehäuse des Normalen, um außerhalb dieser Gefängnisse Antworten zu finden. Was ich auf dieser Suche fand, war je nach Lebensabschnitt verschieden - oder dasselbe, nur verschieden ausgedrückt.
Heute nenne das gute Leben ein ekstatisches. Trotz der Assoziationen, die das Wort bei vielen weckt, die es in Zusammenhang mit Drogenrausch und anderen Exzessen bringen. Für mich ist das ekstatische Leben mehr ein Bei-mir-sein als ein Aus-mir-heraustreten. Ich trete dabei zwar aus der konditionierten Welt meines Alltagsegos heraus, kehre aber zugleich ein in ein erweitertes Bewusstsein. Es ist ein Ankommen bei mir selbst, in einer echteren Realität als der üblichen, die wir für normal halten.
Glückstrancen
Schon als Kind und Jugendlicher kannte ich ekstatische Zustände, hatte aber kein Wort dafür. Sie verstärkten sich auf meinen Tramp-Reisen durch Europa und Südasien. Ich war lieber allein in der Natur als unter Menschen. Mal Flöte spielend, mal nur schauend.
Allein am Wasser, an einem See oder Fluss, am liebsten am Meer. Vom Strand oder einer Steilküste aus schaute ich auf die glitzernde Wasseroberfläche. Auch heute noch versetzt mich das in Entzücken. Diese Glückstrancen sind keine eingeschränkten, sondern erweiterte Bewusstseinszustände, denn mein Normalbewusstsein ist dabei voll intakt und zugänglich.
Alexis Zorbas' Seilbahn
Niemand muss sich um mich sorgen, wenn ich in einer solchen Trance bin; eher sorge ich mich dabei um die damit nicht Beglückten. Für mich verschwindet dieser Zustand auch nie ganz. Sogar während der Qualen im Zahnarztstuhl, die ich kürzlich wieder erlitt, ist diese Ekstase nicht ganz weg. Sie verblasst dabei allerdings und geht bei starken Qualen gegen null. Auch bei einer Enttäuschung, wenn etwas mühevoll Unternommenes nicht gelingt, verblasst sie. Alexis Zorbas in dem gleichnamigen Film, als er die Seilbahn vor seinen Augen kollabieren sieht und dabei nach einem ersten Schrecken schallend lachen muss über dieses grandiose Schauspiel; das ist ein schönes Beispiel für das Wiederaufstehen nach einer Enttäuschung, diese unbändige Lebenslust, die sich nicht kleinkriegen lässt.
Bin ich ein Sonderling?
Bin ich ein Sonderling, dass ich so empfinde? Im Alter von 23 Jahren nahm ich im Südosten Thailands an einem Vipassana-Retreat teil und sank dabei in eine tagelang währende Glückstrance. Die war so stark, anhaltend und immer wieder aufrufbar, dass ich mein Leben nun ganz diesem Weg widmen wollte und buddhistischer Mönch wurde. Meine Sehnsucht nach Transzendenz und die dabei gemachten Erfahrungen schienen mir nun nicht mehr als etwas völlig Außerirdisches, das mich vom Normalen absonderte, denn nun wusste ich von einem, dem ich folgen konnte; er hatte vor 2500 Jahren diesen Weg gefunden und publik gemacht, und daraus war eine über Jahrtausende weiter wirkende gesellschaftliche Tradition geworden.
Die stillen Ekstasen der Einkehr
Noch immer gerne abstrakt denkend, will ich alles verstehen und unterscheide heute, als über 70-jähriger, zwei Arten von Ekstasen. Zum einen die innere Ekstase, die alle Kulturen kennen. Manchmal wird sie eingeleitet durch Rituale wie das Anrufen von Geistwesen oder das christliche Abendmahl. Bei Indigenen oft begleitet von psychedelischen Substanzen, die ermöglichen "mit den Göttern zu sprechen". Wahrscheinlich war auch das größte Heiligtum der europäischen Antike, der Apollotempel zu Delphi, ein Ort, an dem tranceinduzierende Dämpfe aus der Erde traten. Falls nicht schon das Aha-Erlebnis des Diktums "Mensch, erkenne ich selbst" am Eingang dieses Tempels den Besucher in tiefes Entzücken versetzt hatte, konnte er dort einen solchen Dampf einatmen, oder die Orakelpriesterin würde es für ihn tun.
Die äußeren Ekstasen des Flow
Den stillen Ekstasen der Einkehr und Einsicht gegenüber stehen die äußeren Ekstasen des hingebungsvollen Tuns. Der Glücksforscher Mihály Csíkszentmihályi prägte dafür in seinem Buch Das Flow-Erlebnis 1975 diesen Begriff, der daraufhin in weiten Kreisen Karriere machte. Als meine Eltern mich bei Geburt Wolf nannten und ich als Fünfjähriger im Spiel mit meiner Schwester das Wort zu "Flow" umdrehte, verstanden wir Kinder weder Englisch, noch gab es Studien zum Flow-Erlebnis. Meine Eltern wussten also nicht, was sie mir mit diesem Namen mitgegeben hatten - sie, die ganz im Weltlichen zuhause waren und mit Ausnahme der Naturerlebnisse meines Vaters ein weitgehend transzendenzfreies Leben führten.
Arbeitsräusche
Als einst stark geforderter Einzelkämpfer für meine Zeitschrift Connection war ich zeitweise im Arbeitsrausch. Meist wurde dieser über Stunden andauernde ekstatische Zustand durch den Druck ausgelöst, etwas "jetzt oder nie" tun zu müssen, sonst würde mein Projekt scheitern. Diesen Kick kennen auch Prokrastinierer, die erst fünf vor zwölf den nötigen Dopamin- oder Adrenalin-Level in ihrem Blut erreichen, um etwas zu erledigen. Wer solche Glücksgefühle des Aktivseins kennt, will sie auch ohne Druck initiieren können und nicht warten wollen, bis es fast zu spät ist - Lebenskunst würde ich das nennen.
Das Grübeln hört dabei auf, Entscheidungen werden ohne Aufschub aus dem Bauch heraus getroffen, der Fokus ist nach außen gerichtet auf das zu erreichende Ziel hin. Wenn mich dabei Wilhelm Reichs Diktum "Arbeit ist sichtbar gemachte Liebe" begleitet, ist der Flow umso schöner.
Fenster zum Himmel
Flow-Erlebnisse gibt es auch ohne Ziel, zum Beispiel beim Tanz zu rhythmischer Musik. Als Jugendlicher konnte ich das nur allein, wenn mich niemand dabei hörte oder sah. Jahre später als Taxifahrer in München war ich zu Beginn meiner Nachtschicht in den anfangs noch leeren Diskos oft der Erste, der sich auf die Tanzfläche traute. Nicht mehr scheu gesehen zu werden, hatte ich da die ganze Fläche für mich: geil! Auch Spiel, Verliebtheit, Sex, Abschied und Humor können ekstatische Erlebnisse sein. Das ist sogar trainierbar. "Fenster zum Himmel" habe ich diese Öffnungen genannt, weil wir durch sie aus unserem kleinen Ich hinausschauen ins große Ganze, in dem wir geborgen sind.
Lieber Schöpfer als Opfer
Seit 2020 habe ich im Rahmen der BeFree-Workshops auf Gut Frohberg diese "Fenster zum Himmel" weiterentwickelt, mit dafür geeigneten Übungen, passender Musik und Zitaten der großen Meister. So sind daraus mehrtägige Workshops entstanden, ähnlich den Humorworkshops, die ich schon Jahre davor entwickelt hatte, in denen wir uns selbst als komische Figur auf den Bühnen des Lebens sehen. Mehr als kreativer Schöpfer denn tragisches Opfer. Hinein in den Flow des Tänzers, Schöpfers, Liebenden, Gestalters, sich einem Tun Hingebenden. Das Ich, das wir dabei wahrnehmen, ist die halbdurchlässige Membran, die uns umgibt. Durch ihre Poren oder die Fenster unseres kleinen Ichs schauen wir hinaus ins Unendliche. Sogar Verschmelzen mit der Umgebung bis hin zum Unendlichen, Ganzen können wir dabei und doch immer auch zurückkehren in die Heimat unseres kleinen Ichs, den Gegenpol der mystischen Erfahrung.
Wolf Sugata Schneider, Jg. 52. 1985-2015. Hrsg. der Zeitschrift Connection. Autor von »Sei dir selbst ein Witz« (2022). Infos und Seminarbuchungen unter www.connection.de
Hinweis zum Artikelbild: © jackfrog – AdobeStock
Wie man lebt, so stirbt man. Vom Leben und Sterben großer Psychotherapeuten ... von Dipl. Psych. Werner Gross
Das Sachbuch widmet sich dem großen Thema Leben und Sterben auf besondere Art: Es stellt Gründer von Psychotherapieschulen in den Mittelpunkt und erzählt über ihren Lebensstil, ihren Sterbensstil und ihr Wirken. Wie haben sie gelebt, durch welche Irrungen und Wirrungen sind sie im Laufe ihres Lebens gegangen, welche Krisen haben sie durchlebt und wie haben sie diese bestanden? Welche Folgerungen haben sie daraus gezogen? Und schließlich: Wie sind sie gestorben? Unterhaltsam und gut lesbar erschließt sich: Ihre Haltung zu Leben und Sterben hat einen Einfluss auf die Entwicklung der jeweiligen Psychotherapie-Methode.
"Die Lebenden schließen den Toten die Augen. Die Toten öffnen den Lebenden die Augen". (Slawisches Sprichwort)
"Übe Sterben!", soll Plato auf seinem Totenbett gesagt haben, als ihn ein Freund gebeten hatte, sein Lebenswerk in einem Satz zusammenzufassen.
Bis in die heutige Zeit haben sich Philosophen in ihren Werken mit Tod und Sterben auseinandergesetzt. Manche meinen sogar, dass Philosophieren nichts anderes bedeutet als Sterben lernen. Trotz der unzähligen wissenschaftlichen Erkenntnisse - der Tod ist und bleibt Mysterium und Tabu. Wir alle werden ihm nicht entgehen und ihn irgendwann erleben. Und ob uns für die Vorbereitung auf diese letzten bewussten Momente wissenschaftliches "Kopfwissen" hilft und Sicherheit gibt, ist doch zumindest fraglich. Ein religiöser Zyniker hat einmal gesagt: "Halte Brot von den Mäusen fern - und Wissenschaftler von der Seele".
Aber man kann noch so viele medizinische Erkenntnisse über unsere letzten Sekunden oder Minuten zusammentragen, noch so viele "Nahtoderlebnisse" dokumentieren, dazu forschen, lesen und diskutieren - die Unsicherheit wird wohl auch zukünftig bleiben. Manche mögen an der Schwelle gestanden und in den dunklen Abgrund (oder in das gleißende Licht) geblickt haben. Sie mögen auch losgesprungen oder gefallen sein - aber niemand der wirklich tot war, ist zurückgekehrt. Wir kennen bestenfalls die ersten Stufen des Sterbens - nicht den Tod.
Allerdings wollen sich viele Menschen damit nicht abfinden. Gerade, wenn sie in seelische Krisen oder emotionale Turbulenzen geraten, zeigt sich eine dem Menschen (anscheinend) innewohnende Tendenz dieses Mysterium psychologisch erklären und verstehen zu wollen. Denn die Auseinandersetzung mit Tod und Sterben gehört in den Kanon der großen philosophischen Grundfragen: Wer bin ich? Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Wie werde ich sterben? Was ist der Sinn meines Lebens? Was soll ich hier? Was ist meine Aufgabe? Was will ich mit meinem Leben machen? Was ist mir wichtig im Leben?
Dabei sind das philosophische (oder religiöse) Fragen. Die Psychologie fragt eher: Warum, wodurch und wie bin ich so geworden, wie ich bin? Was davon ist veränderbar? Bin ich wirklich "meines Glückes Schmied" oder nur Vollstrecker der in mir angelegten Gene - oder des mir zugedachten Schicksals? Und womit muss ich (wohl oder übel) leben?
Schließlich hängen damit Fragen der Persönlichkeitsstruktur (früher nannte man das Charakter), der Zufriedenheit und des Glücks zusammen: Bin ich nur alt geworden oder habe ich etwas verstanden? Habe ich mich nur (bauern-) schlau durchs Leben geschlagen? Oder bin ich auch ein bisschen (lebens-) weise geworden? Muss man das Leben verstehen - oder reicht es sich darin zurecht zu finden?
Vor allem die Psychotherapie als Krankenbehandlung erweitert dann diese Fragen gern. Schließlich fragen sich viele Psychotherapiepatienten: Warum bin ich psychisch oder körperlich krank geworden? Bin ich selbst verantwortlich für das, was ich bisher mit meiner Lebenszeit gemacht habe (nach dem Motto: "selbst schuld")? Oder bin ich einfach nur Opfer der genetischen, familiären oder gesellschaftlichen Verhältnisse? Welche Krisen habe ich nicht angemessen bewältigt? Oder bin ich einfach nur zu weit von meinem mir vorgegebenen Weg abgekommen und im Dickicht des unvorhersehbaren Lebens mit seinen Irrungen und Wirrungen in einer Sackgasse gelandet, aus der ich ohne die Hilfe einer Psychotherapie (oder durch Sinnsysteme von der Stange, wie sie Religionen bieten) nicht mehr rausfinde?
Im Grunde haben diese Fragen damit zu tun, dass wir als Menschen in einem hohen Maß durch das, was uns im Laufe unseres Lebens passiert, formbar sind - leider auch verformbar. Anders als andere Lebewesen auf dieser Erde, sind wir Menschen schließlich "physiologische Frühgeburten", die viel unfertiger und verletzlicher in diese Welt geworfen werden.
Ein Hund, eine Katze, ein Pferd, brauchen natürlich nach der Geburt auch den Schutz, die Pflege und die Nahrung ihrer Eltern und ihres Umfeldes - aber sie sind schon bald nach der Geburt in der Lage sich von den Eltern weg zu bewegen und die Welt zu erkunden.
Wir Menschen sind in einem viel höheren Maß unfertig und abhängig von einem wohlwollenden direkten Umfeld - sprich: Mutter, Vater, Familie. Wir brauchen einen "sozialen Mutterleib", der uns schützt und uns prägt, formt und nachreifen lässt. Dieses Umfeld kann positiv sein, indem es die in uns angelegten Fähigkeiten fördert und hilft sie zu entwickeln, aber wir sind auch durch Erziehung und dramatische Lebensereignisse viel gravierender verformbar. Und das trifft natürlich nicht nur für die frühe Kindheit zu, sondern diese grundlegende Verletzlichkeit (Vulnerabilität) begleitet uns lebenslang - auch wenn wir sie nicht gern wahrhaben wollen.
Wie wir mit den Herausforderungen des Lebens umgehen (lernen), das macht unsere psychische Stärke oder Schwäche aus. (Andererseits hat vielleicht auch die Entwicklung unseres Gehirns genau mit dieser Sensibilität und Verletzlichkeit zu tun, denn unser Gehirn ist eine lebenslange Baustelle, die nie fertig wird - aber das ist ein ganz anderes Thema.)
Je gravierender die alltäglichen Niederschläge, die Verletzungen und Verformungen sind, die uns das Leben zumutet und antut (oder die wir selbst beispielsweise durch Fehlentscheidungen produzieren), umso näher rückt die Suche nach Unterstützung. In der heutigen Zeit ist das meist die Psychotherapie. Was früher und in anderen Kulturen eher Priester, Schamanen, Medizinmänner oder Gurus waren, sind (zumindest in unserem Kulturkreis) heutzutage Psycholog*innen und Psychotherapeut*innen. Diesem relativ jungen Berufsstand werden denn auch von der Allgemeinbevölkerung alle möglichen - mehr oder weniger magischen - Fähigkeiten angedichtet. Sie sollen uns helfen diese alltäglichen Niederschläge zu verstehen, zu verarbeiten, uns aus diesem Sumpf des Alltags rausziehen und uns wieder fit machen für den Lebenskampf - gerade in unsicheren Zeiten.
Dabei gibt es eine Vielzahl von psychotherapeutischen Schulen, die ganz unterschiedliche Wege und Strategien entwickelt haben, um uns zu helfen zu verstehen, wer wir sind, wie wir in diese Situation geraten sind - und wie wir wieder rauskommen.
Diese Psychotherapieschulen gehen meistens auf eine Gründerfigur zurück - mitunter auch auf mehrere. Allerdings: Psychologen und Psychotherapeut*innen wissen oft wenig über das Leben von den Gründern der Psychotherapieschulen, mit deren Methoden sie arbeiten. Viele wissen nicht einmal, wie diese gelebt haben, durch welche Irrungen und Wirrungen sie im Laufe ihres Lebens gegangen sind, welche Krisen sie durchlebt und wie sie diese bestanden haben. Welcher Lebensstil ist schließlich daraus erwachsen - und was hat dieser Lebensstil zu tun mit der Psychotherapiemethode und der Theorie, die sie entwickelt haben? Gibt es da prägnante Ereignisse und Erlebnisse - und finden diese ihren Niederschlag in der Entwicklung der Psychotherapie-Methode (z. B. Freud, sein Rachenkrebs und die Postulierung der "Destrudo" (Todestrieb) als Gegenpol zur Lebensenergie "Libido")? Und schließlich: Wie sind sie gestorben? Gibt es einen Zusammenhang zwischen Lebensstil, Sterbensstil und Psychotherapiemethode?
Denn ohne Zweifel gibt es eine Reihe Psychotherapeuten, Ärzte und Psychologen, die der Psychotherapie - dieser im Vergleich zu anderen medizinischen Fakultäten noch ganz jungen Heilmethode - ihren prägenden Stempel aufgedrückt haben. In ganz besonderer Weise sind das natürlich die Gründer von Psychotherapieschulen:
Sigmund Freud (Psychoanalyse), Alfred Adler (Individualpsychologie) oder Carl Gustav Jung (Analytische Psychologie). Doch auch die Gedanken von Jacob L. Moreno, dem Begründer des Psychodrama, Fritz Perls (Gestalttherapie), Wilhelm Reich (körperpsychotherapeutische Verfahren), Karlfried Graf Dürckheim (Initiatische Therapie) und Nossrat Peseschkian (Positive Psychotherapie) ziehen auch heute noch ihre Spuren durch den psychotherapeutischen und psychologischen Kosmos. So groß ihre Ideen auch waren - in ihrer Zeit verstarben auch die großen Psychologen menschlich. Schließlich: Niemand entkommt dem Leben lebendig.
Keine Frage: Es gibt Lebensstile, also die individuelle Art und Weise wie jemand sein Leben - mehr oder weniger bewusst - gestaltet. Keiner wird bezweifeln, dass dieser Lebensstil - wenigstens zum Teil - willentlich beeinflussbar ist. Sicher ist dieser Lebensstil nicht durchgängig gleichbleibend, hängt mit der Persönlichkeitsstruktur eines Menschen zusammen und ist mitunter von Lebensphase zu Lebensphase verschieden - auch abhängig davon, was der einzelnen Person im Leben so alles passiert ist ("life-events") und wie man gelernt hat damit umzugehen. Allerdings - die Grundmuster bleiben oft erhalten.
Aber gibt es auch so etwas, wie einen Sterbensstil, also die vorgeprägte Art und Weise, wie jemand stirbt? Und: Kann man ihn willentlich beeinflussen oder sind wir diesem Prozess mehr oder weniger ausgeliefert? Und gibt es einen Zusammenhang zwischen Lebens- und Sterbensstil? Hat der Lebensstil einen Einfluss darauf, wie jemand stirbt? Oder ist er das Ergebnis eines bestimmten Lebensstils, für den man quasi die Quittung bekommt?
Mit diesen Fragen habe ich mich seit Mitte der 80er Jahre immer wieder beschäftigt. Und das fing ganz unspektakulär an. Ich erinnere mich noch ganz genau, obwohl es schon eine ganze Weile her ist: Es war an einem für einen Mai ungewöhnlich heißen Sonntag. Wir lagen auf einer Wiese in der Nähe eines kleinen Dorfes im hessischen Vogelsberg. Die Bienen summten, die Schmetterlinge flatterten, das Bächlein gluckerte idyllisch. Es war fast windstill, nur ein paar Schleierwolken verdunsteten leise am Himmel und die Sonne brannte. Wir hatten gerade ein kleines Picknick hinter uns, entspannten, lasen und dösten vor uns hin, als meine Partnerin sagte: "Du hast da einen merkwürdig unregelmäßigen Leberfleck auf deinem Rücken. Das sollte sich mal ein Arzt ansehen." Zunächst dachte ich mir nichts dabei, zumal meine Partnerin nur allzu oft hypersensibel auf alle möglichen kleinen Veränderungen reagierte und Wehwehchen gern übermäßig ernst nahm.
Aber irgendetwas in mir ließ mich nicht in Ruhe. Also ging ich ein paar Tage später wirklich zu meinem Hautarzt. Als er bedenklich den Kopf hin- und herwiegte und sagte: "Das sieht wirklich nicht gut aus. Das müssen wir einschicken.", war ich wie vor den Kopf geschlagen. In dieser Woche, bis das Ergebnis der Untersuchung aus dem Labor kam, geriet mein inneres Karussell ins Trudeln. Nachts wachte ich schweißgebadet auf und schreckte aus verrückten Träumen auf, mit irgendwelchen absurden Krankheitsverläufen, Operationen und Beerdigungen.
Krankheit und Tod war plötzlich etwas, was nicht nur mit den anderen Menschen - vor allem den Patienten - zu tun hatte, sondern auch mit mir selbst. Die eigene traumwandlerische Sicherheit und das Gefühl der Unverletzlichkeit waren verloren gegangen. Nicht nur der berufliche Alltag war bleiern geworden, sondern auch das Privatleben war zäh, mühselig und mir war ständig leicht schwindelig. Ich hatte das Gefühl, mir wäre ein Bumerang gegen den Hinterkopf geknallt und ich hätte eine leichte Gehirnerschütterung. Es war wie ein Rendezvous mit meinem Schicksal.
In dieser Zeit hatte ich meine Ausbildung zum Psychotherapeuten schon vor einiger Zeit beendet. Und natürlich waren Krankheit, Sterben und Tod auch Themen in meiner Selbsterfahrung und Selbstanalyse gewesen, aber das hatte plötzlich eine ganz andere Intensität und Ernsthaftigkeit bekommen. Es war so, als hätte ich bisher viele theoretische Konzepte über das Schwimmen gelernt und auch im Trockenschwimmen ausgiebig geübt - aber plötzlich war ich durch dieses Erlebnis ins Wasser geschubst worden und musste jetzt sehen, wie ich den Kopf wieder über die Wasserkante bekomme und dabei trotzdem mein Ziel nicht aus den Augen verliere und zügig weiter schwimme.
Gerade hatte ich eine kleine Privatpraxis in Frankfurt eröffnet, arbeitete aber auch noch als Journalist und Publizist. Und mich interessierte das Thema, was denn die wirklichen Unterschiede zwischen den verschiedenen Psychotherapieschulen ausmacht - und zwar nicht nur mit welchen Methoden und Techniken sie arbeiten, sondern auch die theoretischen Grundlagen, auf denen sie fußen - also: Philosophie, Menschenbild, Krankheitsbegriff, Therapieziele, etc.
So kam ich unweigerlich zu den Personen, die die Psychotherapieschulen begründeten. Um was für Menschen handelte es sich dabei? Wie kamen sie dazu ihre Methode zu entwickeln? Welche Irrungen und Wirrungen haben sie im Laufe ihres Lebens durchlaufen? Wie haben sie diese bewältigt? Was davon hat seinen Niederschlag in den Psychotherapiemethoden gefunden?
So habe ich mich als Psychologe und Psychotherapeut mit dem Leben und Sterben großer Psychotherapeuten beschäftigt, vielleicht mit der (mehr oder weniger bewussten) Frage: Was kann ich davon für mich und mein Leben, aber auch für meinen Beruf lernen?
Also habe ich Leben und Sterben von Freud, Jung, Adler und anderen Psychotherapeuten studiert und habe dort, wo es möglich war, Interviews gemacht - mit den Gründern von Psychotherapieschulen (so sie noch lebten), mit ihren Kindern und mit engen Schülerinnen und Schülern, die noch persönlich mit ihm gearbeitet haben.
Und da kam mir mein zweiter Beruf als Journalist und Publizist zur Hilfe. In dieser Zeit habe ich - neben den Buchveröffentlichungen - vor allem für verschiedene öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten gearbeitet und hauptsächlich psychologische Themen für Kultur- und Wissenschaftssendungen aufbereitet und produziert.
So konnte ich für das Thema Tod und Sterben der großen Psychotherapeuten, wie Karlfried Graf Dürckheim, Alexandra und Kurt Adler, Marie Louise von Franz, Hamid Peseschkian, Jacob L. Moreno, Fritz Perls, Wilhelm Reich, mehrere Redaktionen gewinnen und Interviews führen.
In der Auseinandersetzung mit den Lebensläufen und der Methode der verschiedenen Psychotherapeuten und der Art und Weise wie sie gelebt haben und gestorben sind, stand immer auch die Frage: was davon habe ich in meine psychotherapeutische Arbeit übernommen - und was ist mir ferngeblieben? Was an Methoden passt zu mir - und was nicht?
Aber es kam noch etwas hinzu: ich wollte nämlich herausfinden, ob es nicht nur einen Zusammenhang zwischen Lebens- und Sterbensstil gibt, sondern, ob auch die Entwicklung der Psychotherapiemethode irgendwie damit verknüpft ist.
So ist das Ziel meines Buches: das Wissen über das Leben und Sterben der großen Psychotherapeuten zu vermitteln - und was es mit der Entwicklung ihrer Psychotherapiemethode zu tun hat.
Und ist die implizite These richtig, dass es einen Zusammenhang zwischen persönlichem Lebensstil, dem Sterbensstil und der Entwicklung der jeweiligen Psychotherapiemethode gibt?
Ganz abgesehen davon, ist natürlich die allgemeine Auseinandersetzung mit dem Thema Leben, Sterben und Tod etwas, was die meisten von uns - ganz unabhängig von irgendwelchen Psychotherapeuten - interessiert (oder zumindest interessieren sollte). Zu diesen allgemeinen Fragen, gibt es in meinem Buch in den jeweiligen Übergangskapiteln ("Interludium") den ein oder anderen Gedanken. Auch wenn wir es gern verdrängen, lugt dahinter versteckt ja die Frage hervor: Wie wird es wohl bei mir sein? Wie werde ich wohl sterben?
Dipl.-Psych. Werner Gross ist Psychotherapeut, Supervisor und Coach, Organisations- und Unternehmensberater. Er leitet eine psychologische Praxis in Gelnhausen und ist im Leitungsteam des Psychologischen Forums Offenbach (PFO), Lehrbeauftragter für Psychologie an verschiedenen Universitäten und Ausbildungsinstituten für Psychotherapeuten. Weitere Infos unter: www.wernergross.com
Buchtipp:
Werner Gross: Wie man lebt, so stirbt man. Springer Sachbuch 2021. Broschur, 190 Seiten, 19,99 Euro, ISBN 978-3-662-63174-4
Hinweis zum Artikelbild: © Wirestock – AdobeStock
Ich bin hingegangen ... Rainer Taufertshöfer
Ich bin hingegangen, um zu verstehen. Nicht mit dem Kopf - sondern mit dem Herzen.
Ich bin kürzlich nicht in diesen Hundezuchtbetrieb gegangen, um zu prüfen, warum Behörden so etwas nicht schließen. Das kam erst später. Ich bin hingegangen, weil ich mir ein eigenes Bild machen wollte. Nicht theoretisch. Nicht aus Berichten. Sondern real. Nicht als Funktionsträger. Nicht als Aktivist. Sondern als jemand, für den Hunde Familie, Bindung, Wesen, Seele sind.
Hunde sind für mich keine Haustiere. Keine Projekte. Keine Objekte. Sie sind Gefährten. Spiegel. Beziehungswesen. Und genau deshalb wollte ich sehen, wie ein Hundezuchtbetrieb tatsächlich aussieht. Was ein Hund erlebt, bevor er "abgegeben" wird. Wo sein Leben beginnt.
Was ich dort gesehen habe, hat mir den Boden unter den Füßen weggezogen. Ein dunkler Stall. Kaum Licht. Kein Fenster im direkten Lebensbereich der Tiere. In einer 3-Quadratmeter-Box, eingefasst von einem etwa 40 cm hohen Rand, sechs Welpen, sechs junge Seelen. Über ihnen hing eine kleine Rotlichtlampe - im eiskalten Stall. Unter ihnen dünnes Stroh auf blankem Betonboden. Kein Rückzugsort. Keine Struktur. Kein Raum für Beziehung.
Der Stall war formal sauber. Aber es roch schwer nach Urin und Kot. Dieser Geruch, der sich festsetzt - weil hier Leben nicht begleitet, sondern verwahrt wird.
Und dann die Mutterhündin. Ich hatte keinen Zugang zu ihr. Nicht, weil ich mich ihr aufgedrängt hätte. Nicht, weil ich laut oder fordernd war. Sondern weil sie in etwa drei Metern Abstand stehen blieb. Reglos. Eingefroren. Voller Angst. Eine Angst, die nicht situativ ist. Sondern tief. Gelernt. Chronisch. So etwas habe ich in über 30 Jahren mit Hunden noch nie erlebt. Keine Neugier. Kein vorsichtiges Annähern. Nur Distanz. Nur Rückzug. Nur Angst.
Im Gang weitere Hunde. Untergebracht in kleinen Hundehütten. Kein Sozialkontakt. Keine Spielsachen. Keine Alltagsgeräusche. Keine Stimmen. Kein Staubsauger. Kein Radio. Kein Leben. Keine Sozialisierung. Null.
Dieser Ort nennt sich Hundezuchtbetrieb. Kombiniert mit Landwirtschaft. Auch Kühe werden dort gehalten - in derselben Atmosphäre: funktional, roh, entkoppelt. Der Bauer: ungepflegt, wortkarg, abweisend. Neben ihm eine junge Angestellte. Kein Gespräch. Keine Offenheit. Kein Bewusstsein für das, was hier entsteht.
Erst nachdem ich das gesehen habe, habe ich verstanden, warum solche Betriebe nicht geschlossen werden. Weil sie formal funktionieren. Weil sie Mindeststandards erfüllen. Weil Angst, Bindungslosigkeit und seelischer Schaden nirgendwo gemessen werden.
Ich habe danach Behörden informiert. Tierschutzorganisationen kontaktiert. Die Realität: Überlastung. Überforderung. Stillstand. Nicht aus Gleichgültigkeit - sondern weil dieses System kollabiert.
Und genau das ist der Kern. Nicht einzelne Bauern. Nicht einzelne Betriebe. Sondern ein System, das Hunde als Ware behandelt, Bindung ignoriert und seelisches Leid nicht kennt. Eine Hündin, die drei Meter Abstand hält, ist kein Zufall. Sie ist das Ergebnis. Und wer Hunde wirklich kennt, wer mit ihnen lebt, wer sie versteht, der weiß: So beginnt kein gesundes Hundeleben.
Und seit diesem Tag trägt mein Herz etwas mit sich, das sich nicht mehr ablegen lässt. Diese Hündin ist nicht erstarrt. Sie ist ausgewichen. Ängstlich. Wachsam. Auf Abstand bedacht. Sie hat mich gesehen - und sie wollte weg. Kein neugieriges Zögern. Kein vorsichtiges Annähern. Kein innerer Konflikt zwischen Angst und Vertrauen. Nur Fluchtbewegung. Nur der Versuch, Distanz herzustellen.
So etwas habe ich in über 30 Jahren mit Hunden noch nie erlebt. Und in diesem Moment war sie nicht nur eine Mutterhündin. Sie war ein Spiegel dessen, was ihren Welpen bevorsteht. Denn während ich dort stand, war da nicht nur ihr Zustand. Da war auch die Trauer um die Welpen. Die Trauer darüber, welchen Start sie ins Leben haben. Geboren in Dunkelheit. Auf Beton. Ohne Reize. Ohne Alltag. Ohne Nähe zu einer sicheren, innerlich ruhigen Mutter.
Was hier fehlt, ist nicht Komfort. Es fehlt Bindung. Es fehlt Leben. Und genau das hinterlässt Spuren. Nicht sichtbar auf Checklisten. Nicht messbar für Behörden. Aber unauslöschlich im Nervensystem.
Solche Bilder gehen nicht weg. Sie setzen sich fest. Sie verändern den Blick. Sie verändern das Herz. Mein Herz hat an diesem Ort geblutet. Leise. Ohne Pathos. Aber tief. Und ich weiß: Solange solche Orte existieren, solange Angst verwaltet wird und seelischer Schaden kein Kriterium ist, wird es weiter bluten. Nicht nur meines. (Dezember 2025)
Rainer Taufertshöfer ist Heilpraktiker, Medizinjournalist, Forscher, Fachbuchautor. Für Informationen, Fragen und individuelle Begleitung: Telefon: 05536–2353056, E-Mail: info@forschungsseminare.de. Weitere Informationen: www.forschungsseminare.de , www.rainer-taufertshoefer-medizinjournalist.de , www.chlordioxid-therapie-seminare.de , Telegram-Kanal: https://t.me/taufertshoefer
Hinweis zum Artikelbild: © FrameShift – AdobeStock
Ashwagandha. Der indische Ginseng und die Königin des Ayurveda ... von Barbara Simonsohn
Ashwagandha, da hatte ich erst einmal einen schönen fernöstlichen Mädchennamen gedacht. Er klingt für mich wie Musik. Wer sich mit dieser Pflanze beschäftigt, stellt fest: es ist "Musik in ihr drin". Nicht nur enthält sie eine Fülle von Vitalstoffen, die synergetisch zusammenwirken als eine Art "Symphonie der Nährstoffe." Sondern Ashwagandha gehört zu den wenigen Adaptogenen, das sind Pflanzen, die sämtliche körperlichen und seelischen Funktionen optimieren. Bekannt als Adaptogene sind der koreanische Ginseng, der sibirische Rosenwurz oder die Chinesische Shisandra-Beeren. Dann gehört Ashwagandha noch zu den wenigen Verjüngungsmitteln oder Rasayanas in der altindischen Ayurveda-Lehre, die nicht nur dem Körper jugendliche Vitalität erhalten, sondern auch degenerativen Gehirnerkrankungen wie Demenz oder Alzheimer vorbeugen oder stoppen. In dieser Pflanze steckt tatsächlich "Musik" drin, und ich hoffe, dass ich durch einen Artikel wie diesen oder mein Buch zum Thema wie ein Paukenschlag Ashwagandha bei uns bekannt mache. Wo gibt es das schon, eine Pflanze, die als "Schlafbeere" - so die Übersetzung ihres Namens - zu einem schnellen und tiefen Schlaf verhilft, einem aber gleichzeitig Energie und Kraft schenkt? Ich hoffe, dass Ashwagandha bald kein Geheimtipp mehr ist, sondern in aller Munde. Mehr als 1500 wissenschaftliche Studien allein bei der medizinischen Datenbank "PubMed", darunter etliche mit Goldstandard, belegen die Wirksamkeit.
Ashwagandha gehört zu den 32 medizinisch aktiven Pflanzen, die weltweit am stärksten nachgefragt sind. Einer Nachfrage von 12.000 Tonnen pro Jahr steht ein Angebot von nur 6000 Tonnen gegenüber. Die Nachfrage auch bei uns hier in Europa steigt und steigt. Jeder, der angefangen hat, den Wurzelextrakt dieser Pflanze einzunehmen, wird sich besser fühlen und mit Stress besser klarkommen. Daher gibt es viele Stammkunden, welche die frohe Botschaft ihren Bekannten und Familienangehörigen weitererzählen. Die "Ashwagandha-Gemeinde" wächst und wächst.
Ashwagandha gehört zu den vielseitigsten Pflanzen, die ich kenne. Nebenwirkungen sind unbekannt, die Heilpflanze ist seit Jahrtausenden erprobt. Ich betrachte den "indischen Ginseng" als intelligentes Superfood für alle Eventualitäten des Lebens. Mit Ashwagandha blüht der Mensch auf, als ob der lang ersehnte Sommerregen endlich auf ein ausgedörrtes Stück Land fällt. Wir kommen "back to balance", zurück ins Gleichgewicht.
Was ist ein Adaptogen?
Das Wort "Adaptogen" kommt aus dem lateinischen "adaptare ", was so viel wie "an- oder ausgleichen" heißt. Adaptogene optimieren alle körperlichen und psychischen Funktionen in Stresssituationen, sie erhöhen unsere körperliche Widerstandsfähigkeit und seelische Resilienz, und sie gleichen sowohl Defizite als auch Überfunktionen aus. Der Begriff wurde 1947 von dem russischen Pharmakologen Nikolai V. Lazarev geprägt. Mit etwa 1200 Wissenschaftlern gelang ihm der Nachweis, dass es Wirkstoffe aus dem Pflanzenreich gibt, die dem menschlichen Organismus helfen, besser mit Stresssituationen umzugehen, indem sie die körpereigene unspezifische Abwehr steigern. Und das alles ohne Nebenwirkungen. Donals R. Yance definiert in seinem epochalen Werk "Adaptogene in der medizinischen Kräuterheilkunde" den Begriff so: "Adaptogene verbessern die adaptive Reaktion, die der körpereigene Schutzmechanismus ist, und setzen wichtige innerliche Schutzfaktoren ein, um vor chronischen Krankheiten zu schützen und das Leben zu erhalten."
Für den "Vater der Adaptogene" Israel I. Brekman, der mehr als 160 Heilpflanzen daraufhin untersuchte, muss ein Adaptogen auch langfristig eingenommen für den Körper vollkommen unschädlich sein. Ein Adaptogen steigert spezifisch die Widerstandskraft gegen ein breites Spektrum an physikalischen, chemischen und biologischen Einflüssen. Als drittes muss laut Brekmann ein Adaptogen eine normalisierende Wirkung auf den Stoffwechsel erzielen, unabhängig von der Richtung der vorausgegangenen krankhaften Veränderungen. Adaptogene wirken auch prophylaktisch, denn vorbeugen ist besser als heilen. Nach den strengen Anforderungen von Dr. Brekham schafften es nur sechs der 160 untersuchten Pflanzen, diese Kriterien zu erfüllen, darunter auch Ashwagandha. Die Pflanze ist deshalb auch als "Indischer Ginseng" bekannt, weil sie teils ähnliche Inhaltsstoffe aufweist und ein ebenso breites Wirkspektrum. Dabei gibt es aber im Gegensatz zum Koreanischen Ginseng keinen Gewöhnungseffekt und keine Entzugserscheinungen beim Absetzen.
Der Hauptmechanismus der Adaptogene ist ein stressnachahmender hochregulierender Effekt eines bestimmten Hitzeschockproteins. Dieser Eiweißstoff wirkt als Stresssensor und verringert die Menge des kursierenden Cortisols und Stickoxid, Stoffe, die in akuten Stresssituationen und Dauerstress vermehrt ausgeschüttet werden und als Zellgift dauerhaft Schäden anrichten können. Indem beide Stoffe durch ein Adaptogen wie Ashwagandha nicht mehr uferlos ansteigen können, bleibt unsere mentale Leistungsfähigkeit und körperliche Ausdauer auch in Stresssituationen erhalten. Die Mitochondrien - die Kraftwerke in unseren Zellen - werden geschützt, in den Zellen wird mehr Energie - Adenosintriphosphat - erzeugt, und bei sportlicher Betätigung bleiben die Lactatwerte niedrig, und die Regeneration wird gefördert. Erschöpfung und Ermüdung reduzieren sich. Für den Adaptogen-Experten Donald R. Yance ist Ashwagandha "eine gut ausgewogene adaptogene Heilpflanze, die für alle Menschen gut geeignet ist." Ashwagandha erhöht beispielsweise den Serotonin- und Dopaminspiegel, fördert die Reparatur der DNA und verhindert Mutationen der Zelle und reduziert damit die Krebsgefahr.
Wie Ashwagandha auf der seelischen Ebene wirkt
Ashwagandha schützt vor stressbedingten Krankheiten und verhindert die Langzeitschäden von Dauerstress. Sie verlängern unsere Aufmerksamkeitsspanne und steigern unsere geistige Leistungsfähigkeit. Adaptogene erhöhen unsere Belastbarkeit. Wie ein Schirm schützen sie uns vor einem Übermaß an Stress und Überforderung. Sie optimieren die sogenannte Stressantwort. Die Produktion von Stresshormonen wird reduziert, die Nebennieren entlastet und einer Erschöpfung dieses Organs, verbunden mit rapidem Leistungsabfall oder Burnout, wird vorgebeugt. Ashwagandha beruhigt die Nerven, bringt Sympathikus und Parasympathikus in Balance und wirkt angstlösend, antidepressiv und nervenstärkend. Die Pflanze schenkt Energie und gleichzeitig innere Ruhe und heitere Gelassenheit. Ashwagandha wirkt stimmungsaufhellend und -stabilisierend.
Kurz zur Botanik
Ashwagandha wächst in Asien und den Mittelmeerländern, in Afrika und auf den Kanaren. Ihr Ursprung liegt in Indien, Sri Lanka und Pakistan. Es handelt sich bei Withania somnifera, so der lateinische Name, um einen immergrünen Strauch, der bis zu 1 ½ Meter Höhe wächst. Die Blätter sind oval und etwa 10 Zentimeter lang. Die Blüten sind grün bis hellgelb und stehen in Dolden zusammen. Daraus entwickeln sich leuchtend rote Früchte. Die meiste Heilkraft steckt in den Wurzeln, die zylindrisch geformt und fleischig sind und bis zu zwanzig Zentimeter lang wächst.
Warum "Queen of Ayurveda"?
Die altindische Ayurveda-Lehre vom langen und gesunden Leben ist 8000 Jahre alt. Ashwagandha nimmt in der ayurvedischen Arzneimittellehre einen ähnlichen Platz ein, wie Ginseng in der chinesischen Heilkunde und gilt als wirksamste verjüngende Heilpflanze. Diese Pflanzenfamilie mit Verjüngungscharakter wird Rasayana genannt. Ashwagandha nimmt als "Medhyarasayana" eine Sonderstellung ein, weil diese Pflanze den Verstand fördert und die intellektuellen und kognitiven Fähigkeiten. So wird in Indien seit alters her Ashwagandha Kindern mit Gedächtnisdefiziten und Älteren verabreicht, deren kognitiven Fähigkeiten nachlassen. Ashwagandha als "Queen der Ayurveda" und in mehr als 200 ayurvedischen Heilmitteln Bestandteil, wird darüber hinaus als Stärkungsmittel verordnet, als Brusya zur Stärkung der Sexualfunktionen von Mann und Frau, und als "Pustida", als eine gesunde Nährstoffquelle. Unter den Rasayana- und Stärkungsmitteln der Ayurveda-Lehre nimmt Ashwagandha den prominentesten Platz ein.
Die Ayurveda-Lehre nutzt Ashwagandha darüber hinaus bei Diabetes, Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Stresskrankheiten, zur Stärkung des Immunsystems und kognitiven Störungen. Alle diese Indikationen sind von modernen Studien bestätigt worden.
Gesundheitlich relevante Inhaltsstoffe von Ashwagandha
Als biologisch aktive Substanzen stechen mehr als 130 Withanolide oder Steroidlactone hervor, das sind Triterpenoide, die zur Familie der bioaktiven Substanzen oder Pflanzenbegleitstoffe gehören. Die häufigsten sind Withanolid A, Withaferin A, Withanon und Withanolid D. Die Withanolide hemmen das Wachstum von Krebszellen, senken einen zu hohen Blutzuckerspiegel, wirken antioxidativ als Fänger freier Radikaler, schützen die Leber, wirken entzündungshemmend und wirken gegen Alzheimer und Demenz. Sie sind antibakteriell und antiviral wirksam und schützen das Gehirn, sind neuroprotektiv. Sie wirken herzstärkend und senken einen zu hohen Blutdruck und beugen Morbus Parkinson vor. Withanolide in Ashwagandha sind effektive Immunmodulatoren, sie optimieren das Immunsystem.
Es finden sich in der Pflanze auch antioxidativ wirkende Flavonoide wie Kaempferol, Rutin und Quercetin, Bitterstoffe zur Optimierung des Stoffwechsels und gesunde Fettsäuren. Ashwagandha ist mit 119 Milligramm pro 100 Gramm sehr reich an Eisen und wird daher bei Eisenmangel empfohlen. Auch der Anteil der Folsäure ist beachtlich.
Bei welchen Beschwerden Ashwagandha außerdem hilfreich ist
Die Inhaltsstoffe von Ashwagandha helfen, das Fortschreiten der degenerativen Muskelerkrankung ALS oder Amyotropher Lateralsklerose zu verlangsamen und die Symptome zu lindern. Krampflösende Inhaltsstoffe in Ashwaganda verringern die Häufigkeit von epileptischen Anfällen bei Epileptikern. Ashwagandha erhöht die Neuroplastizität, das heißt die Fähigkeit des Gehirns, auch im fortgeschrittenen Alter immer neue Synapsen zu bilden. Schlafprobleme wie Einschlaf- oder Durchschlafprobleme werden gelindert und die Schlafqualität steigt. Ashwagandha hilft bei Depressionen. Die Telomeraseaktivität steigt. Telomerase ist ein Enzym, das die Zellen vor verfrühten Alterungsprozessen schützt. Studien zeigen, dass Ashwagandha als Schutzschild gegen Arteriosklerose, Bluthochdruck und koronare Herzerkrankungen wirkt. Die Pflanze wirkt blutzuckersenkend und beugt damit Diabetes Typ II vor. Die Insulinausschüttung wird gesteigert, und die Fett- und Skelettzellen nehmen mehr Glukose auf. Eine Unter- und Überfunktion der Schilddrüse kann mit Ahwagandha ausgeglichen werden. In zahlreichen Studien haben sich die Withanolide aus Ashwagandha oder ein Extrakt der ganzen Wurzeln als wirksam gezeigt zur Prophylaxe und Therapie von verschiedenen Krebserkrankungen. Bei Männern, die Ashwagandha zu sich nehmen, bleibt die Testesteronproduktion auch im Alter hoch, bei Frauen werden Wechseljahrsbeschwerden gemildert. Äußerlich helfen Auszüge aus Ashwagandha in Salben, Pigmentflecke zu reduzieren.
Eigene Erfahrung
Mein Vater ist im letzten Jahr mit 104 Jahren nach einem erfüllten Leben gestorben. In seinem letzten Lebensjahr profitierte er von der Einnahme von Ashwagandha-Kapseln, die seine Lebensqualität und -freude steigerten, und ihn in die Lage versetzten, die Herausforderungen des Alterns und des Alltags gut zu bewältigen. Bis zuletzt war er geistig rege. Vielleicht ist Ashwagandha kein Allheilmittel, aber wir behalten damit in unserem stressigen Leben leichter Oberwasser. Damit wir unseren Seelenplan erfüllen können nach der Maxime von Mahathma Gandhi, "Sei du die Veränderung, die du von der Welt erhoffst."
Barbara Simonsohn (geb. 1954) ist Ernährungsberaterin und Reiki-Lehrerin. Seit 1995 hat Barbara Simonsohn zahlreiche Ratgeber im Bereich der ganzheitlichen Gesundheit veröffentlicht. Ihre Webseite: www.barbara-simonsohn.de
Buchtipp:
Barbara Simonsohn: Ashwagandha. Wirkung und Anwendung einer uralten Heilwurzel. Unimedica im Narayana Verlag 6.2024, Gebundenes Buch, kart., 150 Seiten, 18,90 Euro
Hinweis zum Artikelbild: © Azay photography_AdobeStock und eingebunden von ShahinAlam_AdobeStock
Aus: Das Evangelium des Thomas. Die Meisterworte Jesu. Übersetzt und kommentiert von Jean-Yves Leloup
.Logion 50.
Jesus sprach:
Wenn man euch fragt: Woher seid ihr?
Sagt ihnen:
Wir sind aus dem LICHT geboren,
dort, wo das Licht selbst geboren wird,
ist es gut
und offenbart sich in ihrem Bilde.
Antwortet:
Wir sind seine Söhne
und wir sind die Geliebten des Vaters, des
LEBENDIGEN.
Wenn man euch fragt:
Welches ist das Zeichen eures Vaters, der in euch ist?
Antwortet ihnen:
Es ist eine Bewegung und eine Ruhe.
(Vergl. Mt 21,3; Lk 17,10; Joh 3,8; 8,14; Lk 16,8; Joh12,36; Eph 5,8; 1 Thess 5,5; Röm 9,26; Lk 21,7)
Die Gnosis ist eine Lichterfahrung - das ist es, was der Mönch Seraphim von Sarow dem Philosophen Motovilov offenbart, als jener ihn in seiner Einsiedelei besucht. Er gibt ihm keine Abhandlung über das Licht, er lässt ihn an seinem ungeschaffenen Glanz teilhaben.
Für Gregor Palamas und die Mönche des Berges Athos ist das Ziel des christlichen Lebens diese Erfahrung des ungeschaffenen Lichts, das im brennenden Dornbusch erstrahlte, auf dem Berg Tabor und am Tage der Wiederauferstehung. "Es ist gut", gut wie ein Ostermorgen. "Das Licht, das jenseits dieses Himmels strahl., jenseits von allem, in den höchsten Welten, über die hinaus es nichts Höheres gibt, ist in Wirklichkeit dasselbe Licht, das im lnnern des Menschen strahlt." (Chandogya Upanishad III, 13,7)
Ebenso muss man auf die dreifache Frage "Woher kommen wir, wer sind wir, und wohin gehen wir?" ohne Zögern antworten: Ich komme aus dem Licht, ich bin Licht, ich kehre zurück ins Licht. Das ist die eigentliche Wahrheit des LEBENDIGEN SOHNES in uns. Es ist die WIRKLICHKEIT, die inmitten der wechselnden Gewandung der Erscheinungen bleibt.
Das Zeichen unserer Verbindung mit der leuchtenden Wirklichkeit "ist eine Bewegung und eine Ruhe". Es ist die Vereinigung der Gegensätze, die Einheit von Handlung und Kontemplation, die Stille im Agieren und die wirksame Ruhe.
Auszug aus: Das Evangelium des Thomas
Die Meisterworte Jesu übersetzt und kommentiert von Jean-Yves Leloup
Aus dem Französischen übersetzt ins Deutsche im Verlag Edition Spuren in 2008. Taschenbuch mit 262 Seiten. Webseite des Verlags: https://spuren.ch
Hinweis zum Artikelbild: © guroXOX_AdobeStock
Astrologische Jahresthemen 2026 ... von Markus Jehle
Auf Sand gebaut
Saturn Konjunktion Neptun in Widder am 20. Februar 2026
Die ersten Wochen des Jahres 2026 sind zunächst geprägt von Verwirrung und Unsicherheit. Wir wissen nicht wirklich, woran wir sind und worauf wir bauen und uns verlassen können. Die Faktenlage ist unklar, und es werden immer wieder Regeln hintergangen und getroffene Vereinbarungen außer Kraft gesetzt. Wir machen uns viele Illusionen, so dass Wunsch und Wirklichkeit kaum noch voneinander zu unterscheiden sind. Daher müssen wir uns stets fragen, was echt ist und inwieweit wir uns und anderen etwas vorzumachen versuchen. Wo getäuscht wird, sind Enttäuschungen vorprogrammiert.
Es ist die Sogwirkung unerfüllter Wunschwelten, die uns in unseren Sehnsüchten und den daraus resultierenden Blasen gefangen hält. Sobald diese Blasen platzen, werden wir jäh aus unserem Träumen gerissen und mit Tatsachen konfrontiert, von denen wir glaubten, sie ignorieren zu können. Nüchternheit ist der Schlüssel, um innerlich Halt zu finden, angesichts des schwankenden Bodens, auf dem wir uns bewegen und der Unsicherheiten, die entstehen, wenn Grenzen verschwimmen und Gewissheiten nicht mehr tragen.
In schöpferischer Hinsicht werden wir von der Muse geküsst wie nur selten zuvor. Auch wenn es Mut und Anstrengung erfordert, gelingt es uns besser denn je, unseren inneren Bildern und Visionen Ausdruck und Form zu geben.
Frei von Besitz
Uranus in Stier bis 26. April 2026
Wir werden uns eingestehen müssen, dass Geld kein Genussmittel ist und unsere Werte sich womöglich in die falsche Richtung verschoben haben. Vielleicht waren wir auch zu gierig und sind zu hohe Risiken eingegangen, für die wir nun mit Verlusten zu bezahlen haben. Uns innerlich frei von Besitzdenken zu machen, hilft uns dabei, uns aus Anhaftungen zu lösen, die uns belasten und uns das Leben unnötig erschweren.
Trost und Zuversicht
Jupiter in Krebs bis 30. Juni 2026
Was uns in der ersten Jahreshälfte 2026 immer wieder nahekommt ist der Wunsch nach Schutz und Geborgenheit. Wir stehen vor der Frage, wie wir unser Einfühlungsvermögen stärken und unsere Zuversicht nähren können. Mehr als sonst sind wir nostalgisch gestimmt und schwelgen gerne in schönen Erinnerungen. Bisweilen sind wir auch zu gutmütig und überfürsorglich im Umgang mit uns nahestehenden Menschen. Da unser emotionales Wohlbefinden hoch im Kurs steht, benötigen wir wirksame Strategien, die uns über Kränkungen hinwegtrösten und unseren Optimismus stärken. Auch wenn es uns manchmal guttut, unseren Gefühlen freien Lauf zu lassen, fällt der daraus resultierende Erkenntnisgewinn eher bescheiden aus.
Die Freiheit der Gedanken
Uranus in Zwillinge ab 26. April
Was uns bislang undenkbar schien, ist in manchen Bereichen längst Wirklichkeit. Wie frei und klug unsere Gedanken tatsächlich sind, dass weiß unser KI-Assistent zunehmend besser als wir selbst. Oder machen unser Denken und unser Sprechen doch noch einen signifikanten Unterschied zum Papageiengeplapper der vorausberechneten Wortsilbenwahrscheinlichkeiten, die unsere KI ausspuckt? Unsere Originalität und Authentizität sind gefordert, um mehr präsent zu sein und nicht fortwährend die Muster und Gedanken aus unserer Vergangenheit künstlich am Leben zu erhalten. Was zählt, sind Ideen, die zünden und Perspektiven, die anders und erfrischend sind. Umdenken ist angesagt, und es gilt Lösungen zu finden, die, auch wenn sie zunächst paradox anmuten, sich dennoch als plausibel und logisch erweisen. Wir dürfen nicht unsere Standpunkte verraten, bloß weil sie unbequem und angeblich aus der Zeit gefallen sind.
Die Weitergabe des Feuers
Löwe-Jupiter zunehmendes Trigon Widder-Neptun am 20. Juli 2026
Welche Ziele die richtigen sind, um neu durchzustarten, das tritt im Sommer 2026 deutlich zutage. Wir strotzen vor Selbstbewusstsein und wollen hoch hinaus. Es braucht nicht viel, um unserer Fantasie freien Lauf zu lassen und weitreichende Pläne zu schmieden. Wir brennen für unsere Wünsche, und wenn wir es damit übertreiben, dann verbrennen wir uns auch daran. Es gilt unser Ego auf spirituelle Werte auszurichten und uns Ziele zu setzen, die im Rahmen unserer Möglichkeiten liegen und nicht nur uns, sondern auch dem Gemeinwohl dienlich sind. Unser Pioniergeist verleiht uns Kraft, und unsere Authentizität stärkt unsere Glaubwürdigkeit und wirkt ansteckend auf andere. Was wollen wir mehr?
Erwachen aus dem Traum
Zwillinge-Uranus zunehmendes Sextil Widder-Neptun am 15. Juli 2026
Aus welchem Geist heraus handeln wir? Was inspiriert uns und weckt unsere Schöpferkraft? Welche Ideen und Gedanken verleihen unserer Seele Flügel? Von unseren Antworten auf diese Fragen hängt es ab, wie gut es uns gelingen wird, in unserem Leben ein neues Kapitel aufzuschlagen und uns langersehnte Wünsche zu erfüllen.
Wir sehnen uns danach, kühne Ideen und Pläne zu schmieden und befreit durchzustarten. Doch um entsprechend voranzukommen, müssen wir viele Vorhaben neu und anders denken. Mit faulen Tricks Handlungsbereitschaft vorzutäuschen und so zu tun als ob, wird uns keine nachhaltigen Vorteile verschaffen. Wir müssen pfiffig sein und schnell, und unseren Worten müssen Taten folgen, damit innerer Frieden einkehrt und wir nicht länger vergeblich vor uns hin kämpfen.
Besitz macht verwundbar
Chiron in Stier vom 19. Juni 2026 bis 18. Sept. 2026
Im Laufe des Jahres machen uns immer wieder schmerzhafte materielle Verlusterfahrungen zu schaffen. Es stellt sich uns die Frage, warum wir unser Eigentum nicht schützen und unsere Werte nicht bewahren können. Womöglich werden wir auch aus angestammten Revieren vertrieben, die uns bislang als stabil und sicher erschienen sind. Warum wir das Feld räumen müssen, hat viel mit innerer Unsicherheit und Selbstwertzweifeln zu tun.
In körperlicher Hinsicht wird uns aufgezeigt, welche Form von Genuss uns schadet. Es gilt zu erkennen, was unsere körperlichen Heilkräfte schwächt und wie wir sie stattdessen stärken können. Dabei spielen auch Fragen nach der richtigen Ernährung eine entscheidende Rolle. Unser Körper heilt sich selbst, und wo dies nicht möglich ist, müssen wir lernen, mit unseren Wunden und Handicaps zu leben.
Das Wichtigste zuerst
Löwe-Jupiter zunehmendes Trigon Widder-Saturn am 1. September 2026
Im Herbst 2026 sind vor allem Entschlossenheit und Mut gefordert, um über Anlaufschwierigkeiten hinwegzukommen und gute Fortschritte erzielen. Wir erkennen zunehmend besser, was im Rahmen unserer Möglichkeiten liegt und wovon wir uns zu viel versprochen und unsere Fähigkeiten und Kapazitäten überschätzt haben. Hindernisse und Widrigkeiten können uns dabei unterstützen, das richtige Maß für uns zu finden und unsere Kräfte zu bündeln und auf diejenigen Ziele auszurichten, die uns am meisten am Herzen liegen. Es ist unser Glaube an uns selbst, der uns den Rücken stärkt und es uns ermöglicht, mehr zu erreichen als wir uns zunächst zugetraut haben. Indem wir unsere Prioritäten richtig setzen, können wir es vermeiden, uns in ausweglose Situationen zu verbeißen und stattdessen nachhaltige Erfolge erzielen.
Die Machtverhältnisse stehen Kopf
Zwillinge-Uranus zunehmendes Trigon Wassermann-Pluto am 18. Juli und 29. November 2026
Wo es uns nicht gelingt, freiwillig umzudenken, werden wir durch äußere Umstände dazu gezwungen. Was auch immer unsere Flexibilität herausfordert, das Chaos hält uns wach. Doch solange es uns an klugen Strategien mangelt, die Dinge in den Griff zu bekommen, werden wir die Zukunft eher fürchten statt sie als Chance zu begreifen, uns aus alten Mustern und Fixierungen zu lösen und anstehende Erneuerungen aktiv mitzugestalten.
Was uns die Freiheit nimmt, kann schwerwiegende Machtkonflikte nach sich ziehen. Wir müssen unser Recht auf Selbstbestimmung und Autonomie mit harten Bandagen verteidigen. Um Teil der Veränderung zu sein, müssen wir uns mit wachen Geistern verbünden und unsere Neugier und Vielseitigkeit unter Beweis stellen. Unsere Unabhängigkeit ist bedroht, und wir stehen unter Zwang, sowohl von innen als auch von außen. Inwieweit Not tatsächlich erfinderisch macht, das offenbart sich uns in der zweiten Jahreshälfte.
Frieden und Freiheit
Widder-Neptun zunehmendes Sextil Wassermann-Pluto am 25. Juli und 16. September 2026
Vertrauen zu können, schenkt uns Kraft für Neues. Es ist mehr miteinander gefordert, um unsere Kraft und unseren Elan zum Wohle aller zur Geltung zu bringen. Alles ist machbar, auch Wunder. Entscheidend ist, dass wir unsere Vorstellungskraft gezielt zum Einsatz bringen und innerlich wandlungsbereit sind, damit wir auch in Umbruchsphasen erfolgreich navigieren und Kurs halten können. Alles ändert sich, und wir ändern uns mit. Etwas anderes bleibt uns gar nicht übrig angesichts der Mächte, die derzeit in uns und um uns walten.
Fazit
Die Schicksals- und Wandlungsplaneten Saturn, Uranus, Neptun und Pluto bilden 2026 eine harmonische Aspektfigur in den Luftzeichen Zwillinge und Wassermann und dem Feuerzeichen Widder.
Uns steht 2026 ein Jahr der Umschwünge und Ernüchterungen bevor. Tendenzen, die sich bereits in den Sommer- und Herbstmonaten des Jahres 2025 abgezeichnet haben, werden zunehmend zur Realität. Es sind insbesondere Vertrauensverluste, die zu großen Verwerfungen führen. Auf der anderen Seite lassen sich Wünsche verwirklichen, die bis vor Kurzem noch undenkbar waren. Da immer wieder Regeln außer Kraft gesetzt werden, lassen sich binnen kurzer Zeit große Veränderungen realisieren. Das sorgt einerseits für Unruhe, während andererseits so manche sich die Hände reiben und mit dem Durcheinander gute Geschäfte machen.
Markus Jehle war 25 Jahre lang Chefredakteur der astrologischen Fachzeitschrift Meridian. Er leitet das 1991 gegründete Astrologie Zentrum Berlin, eines der größten Ausbildungszentren Deutschlands und gibt seit 25 Jahren den Astro-Kalender "Himmlische Konstellationen" heraus. Er ist Autor einer Buchserie zur "Kreativen Astrologie", zu der auch ein Kartenset gehört. Sein Standardwerk "Aphorismen zur Horoskopdeutung" erfreut sich insbesondere bei Einsteigern großer Beliebtheit. Aktuell forscht er zu Priapus und hat dazu mit Anne Probst das Buch "Priapus kommt - Lilith bleibt" veröffentlicht. Kontakt: www.astrologie-zentrum-berlin.de
Buchtipp:
Markus Jehle, Himmlische Konstellationen 2026 - Ein astrologisches Jahrbuch. Leben und Handeln im Einklang mit dem Kosmos. Chiron Verlag (chiron-verlag.de), Hardcover, 10,5 x 16,5 cm, 280 Seiten; 17,95 Euro
Hinweis zum Artikelbild: © kazitafahnizeer_AdobeStock